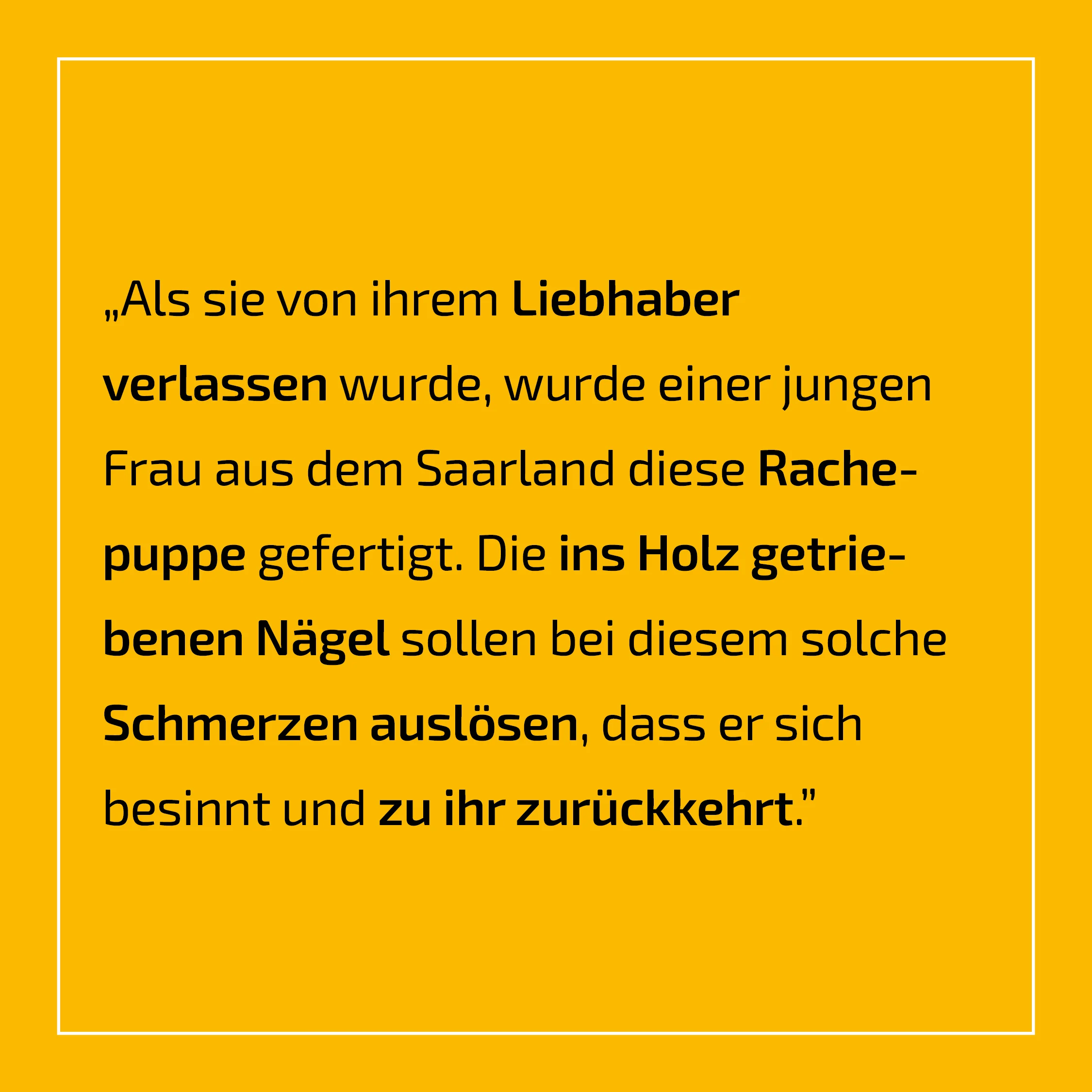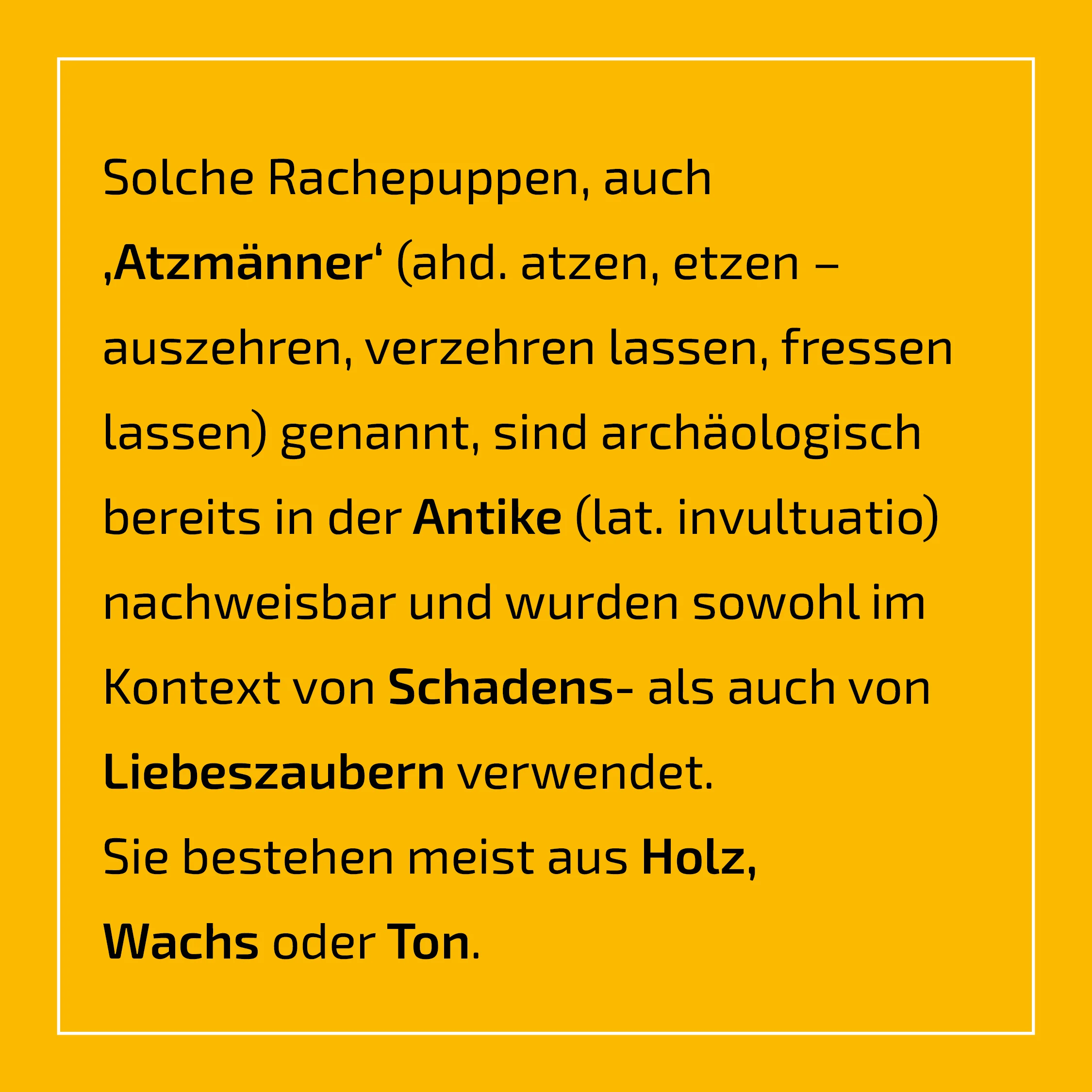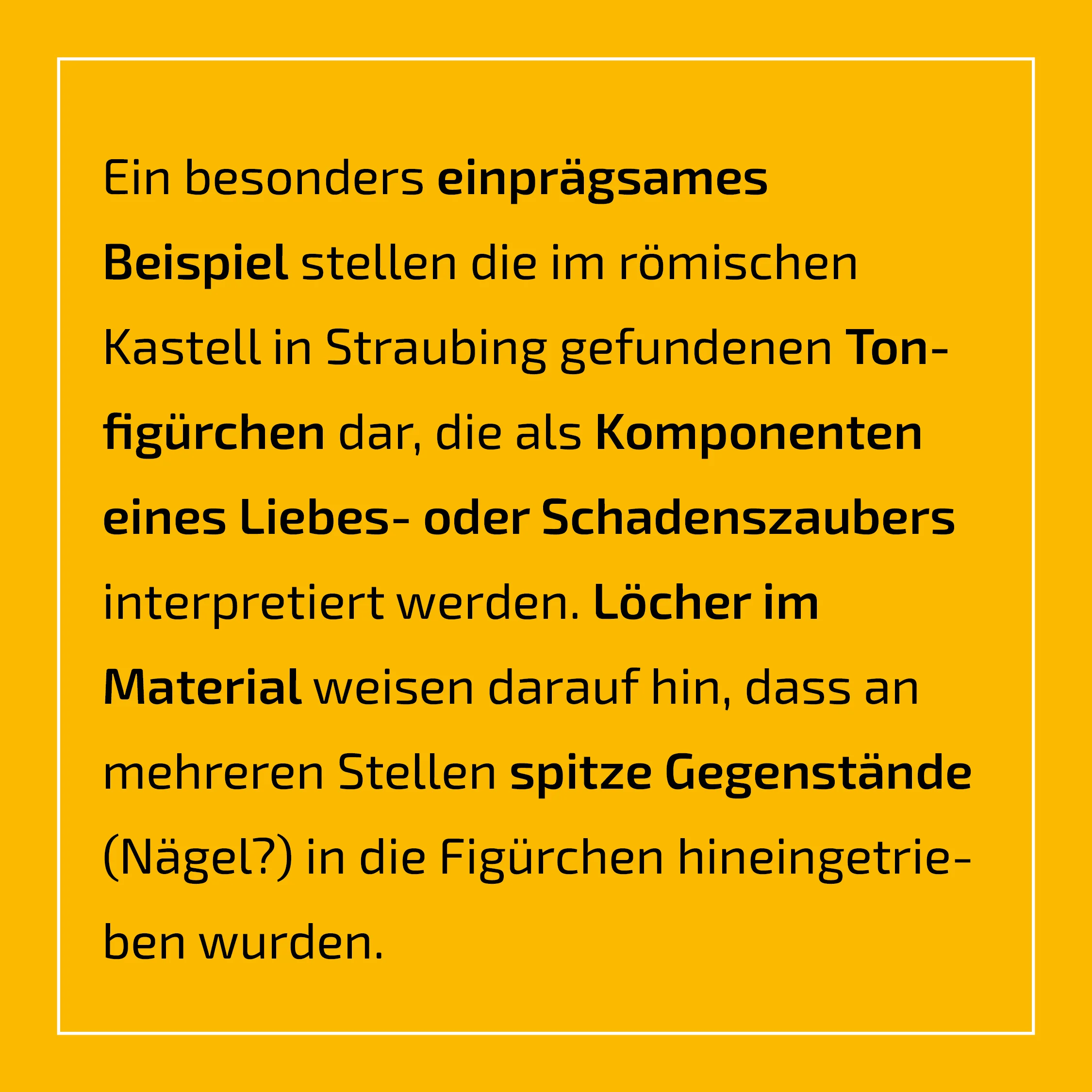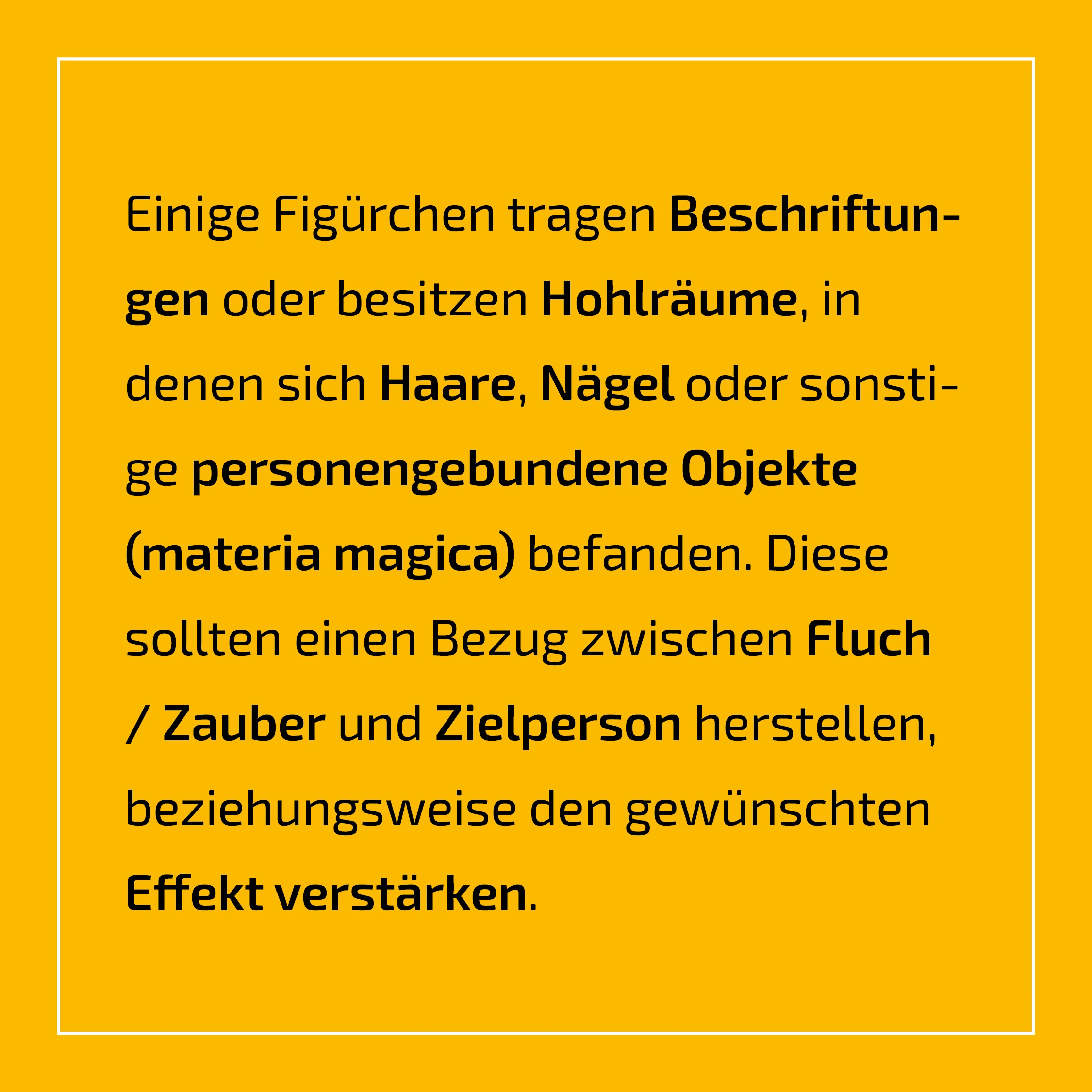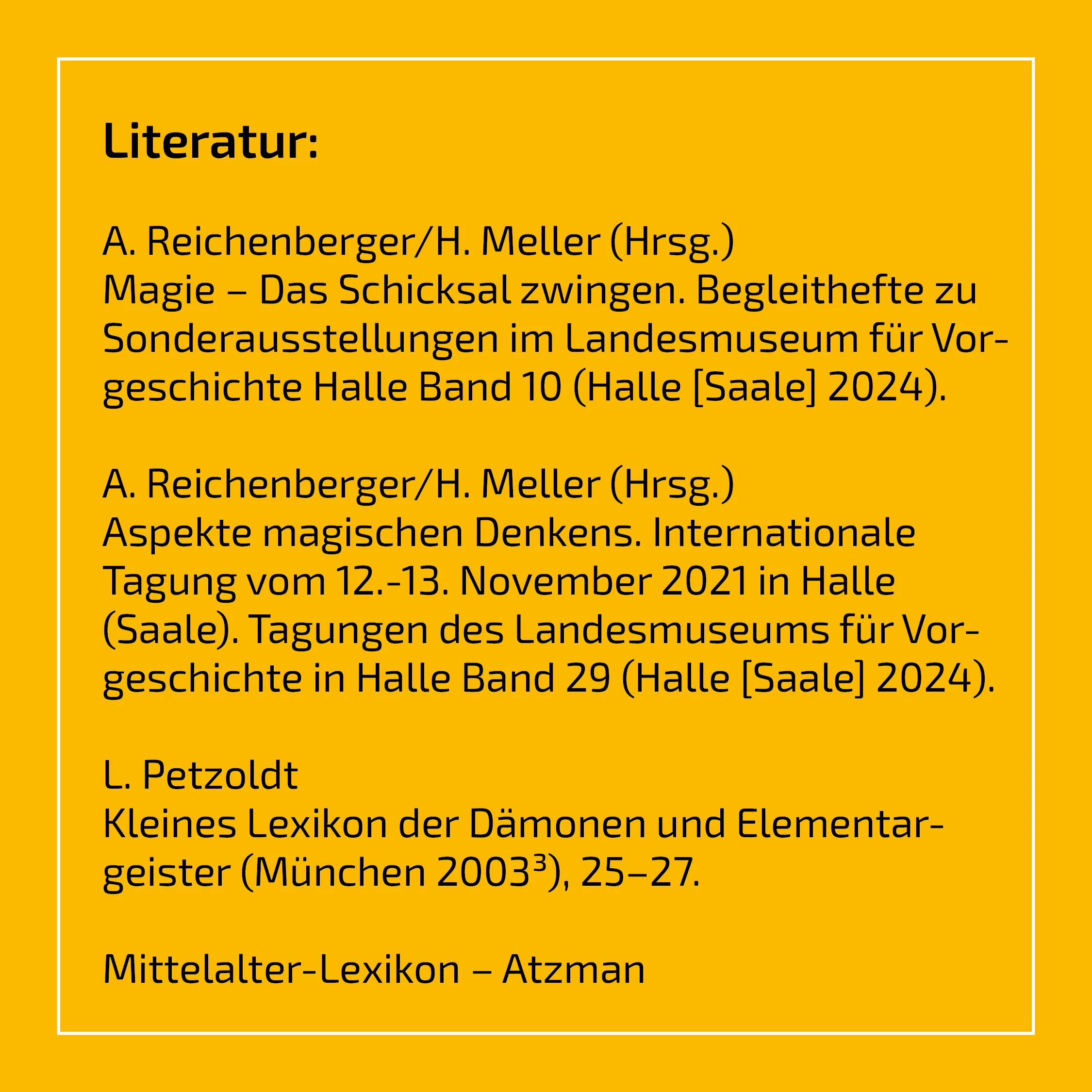Rachepuppen und Schadenszauber
„Als sie von ihrem Liebhaber verlassen wurde, wurde einer jungen Frau aus dem Saarland diese Rachepuppe gefertigt. Die ins Holz getriebenen Nägel sollen bei diesem solche Schmerzen auslösen, dass er sich besinnt und zu ihr zurückkehrt.”
Solche Rachepuppen, auch ‚Atzmänner‘ (ahd. atzen, etzen — auszehren, verzehren lassen, fressen lassen) genannt, sind archäologisch bereits in der Antike (lat. invultuatio) nachweisbar und wurden sowohl im Kontext von Schadens- als auch von Liebeszaubern verwendet. Sie bestehen meist aus Holz, Wachs oder Ton.
Ein besonders einprägsames Beispiel stellen die im römischen Kastell in Straubing gefundenen Tonfigürchen dar, die als Komponenten eines Liebes- oder Schadenszaubers interpretiert werden. Löcher im Material weisen darauf hin, dass an mehreren Stellen spitze Gegenstände (Nägel?) in die Figürchen hineingetrieben wurden. Einige Figürchen tragen Beschriftungen oder besitzen Hohlräume, in denen sich Haare, Nägel oder sonstige personengebundene Objekte (materia magica) befanden. Diese sollten einen Bezug zwischen Fluch / Zauber und Zielperson herstellen, beziehungsweise den gewünschten Effekt verstärken.
In Mittelalter und Neuzeit existierte der Glaube, Menschen mithilfe eines Abbildes töten zu können. Auch aus dem Kontext der Hexenverfolgung ist der Einsatz solcher stellvertretender Artefakte bekannt, die an einem Spieß gebraten, mit Nägeln versehen oder mit Gift bestrichen wurden.
📚 Literatur:
A. Reichenberger/H. Meller (Hrsg.), Magie – Das Schicksal zwingen. Begleithefte zu Sonderausstellungen im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle Band 10 (Halle [Saale] 2024).
A. Reichenberger/H. Meller (Hrsg.), Aspekte magischen Denkens. Internationale Tagung vom 12.-13. November 2021 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle Band 29 (Halle [Saale] 2024).
L. Petzoldt, Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister (München 2003³), 25–27.
Mittelalter-Lexikon – Atzman