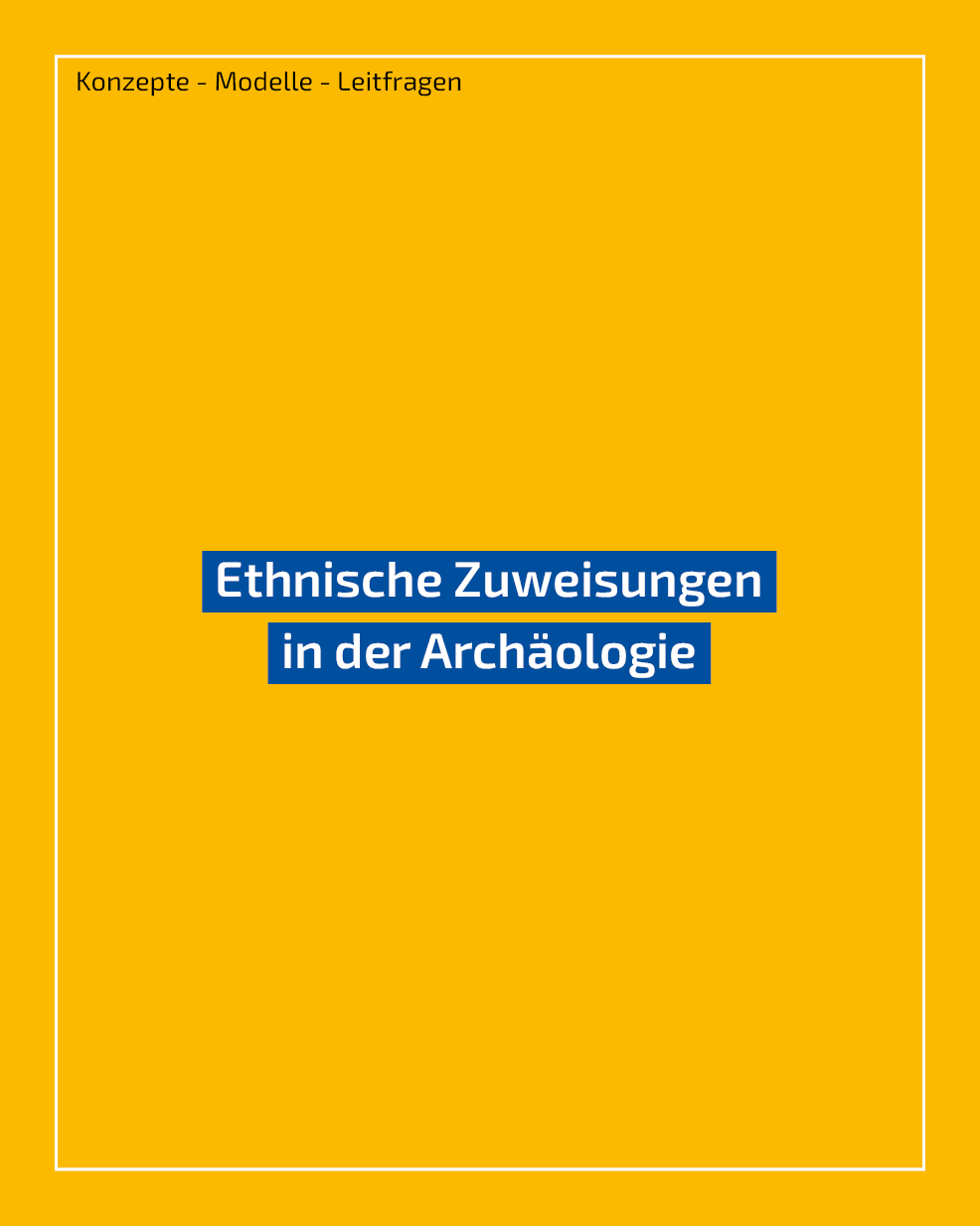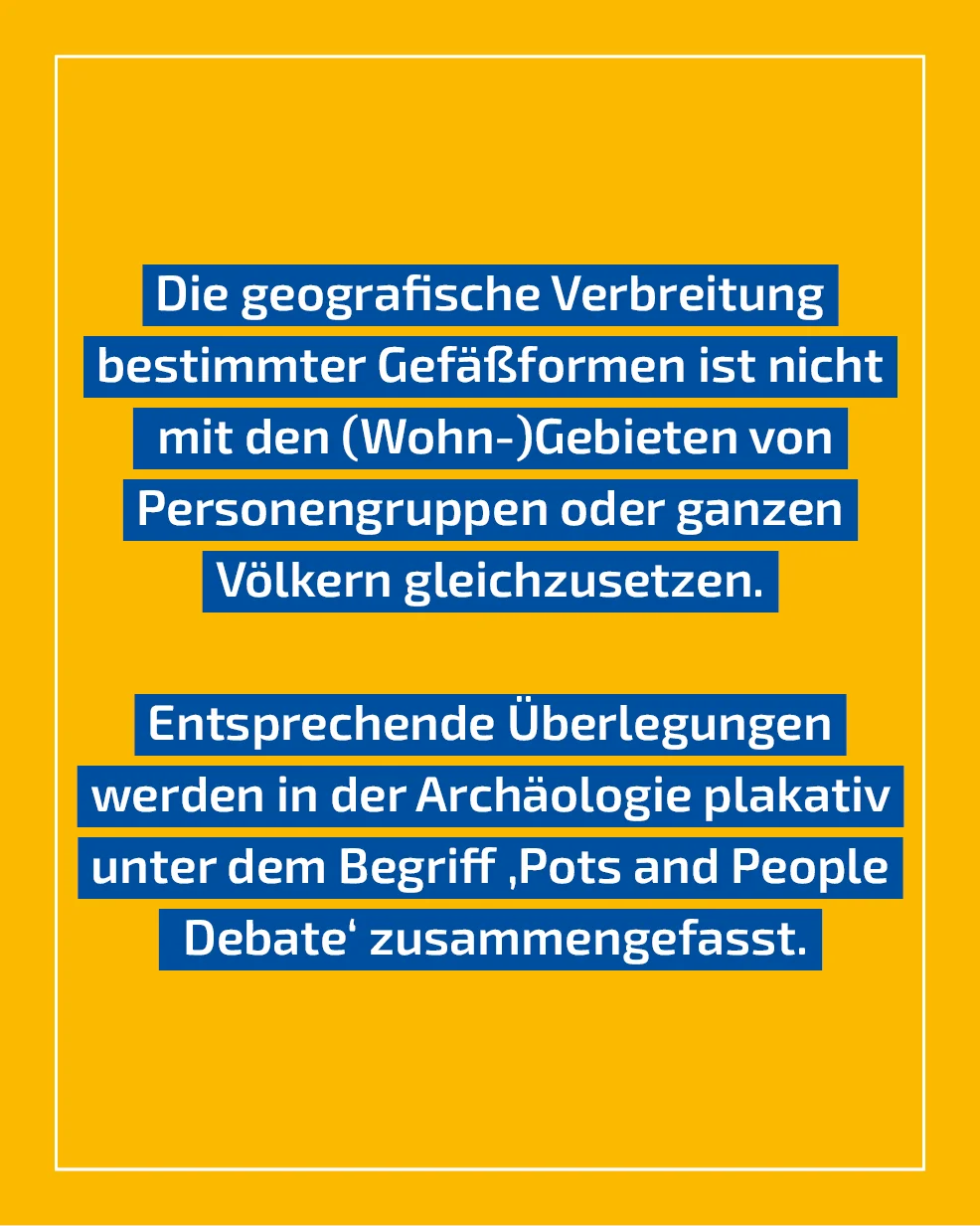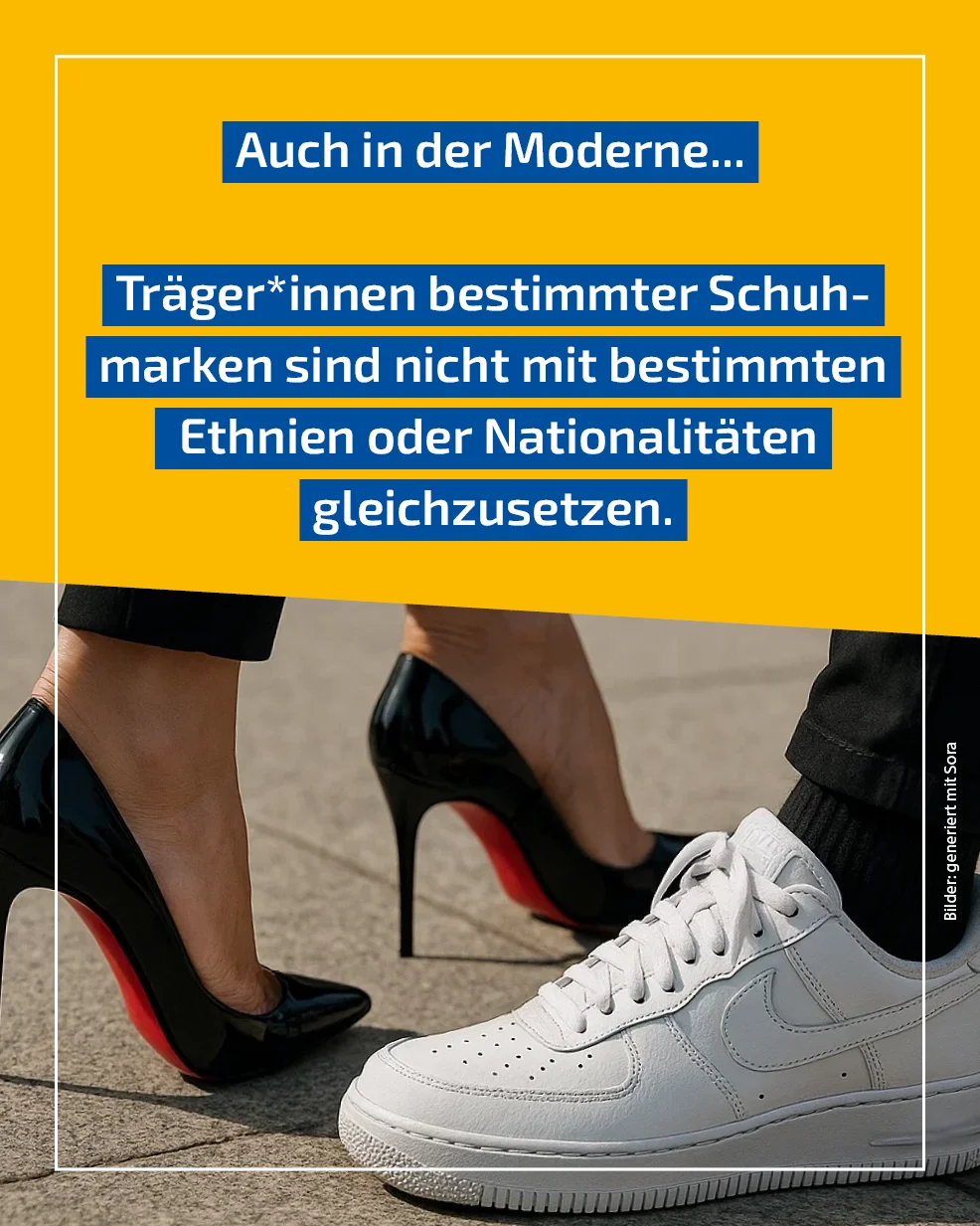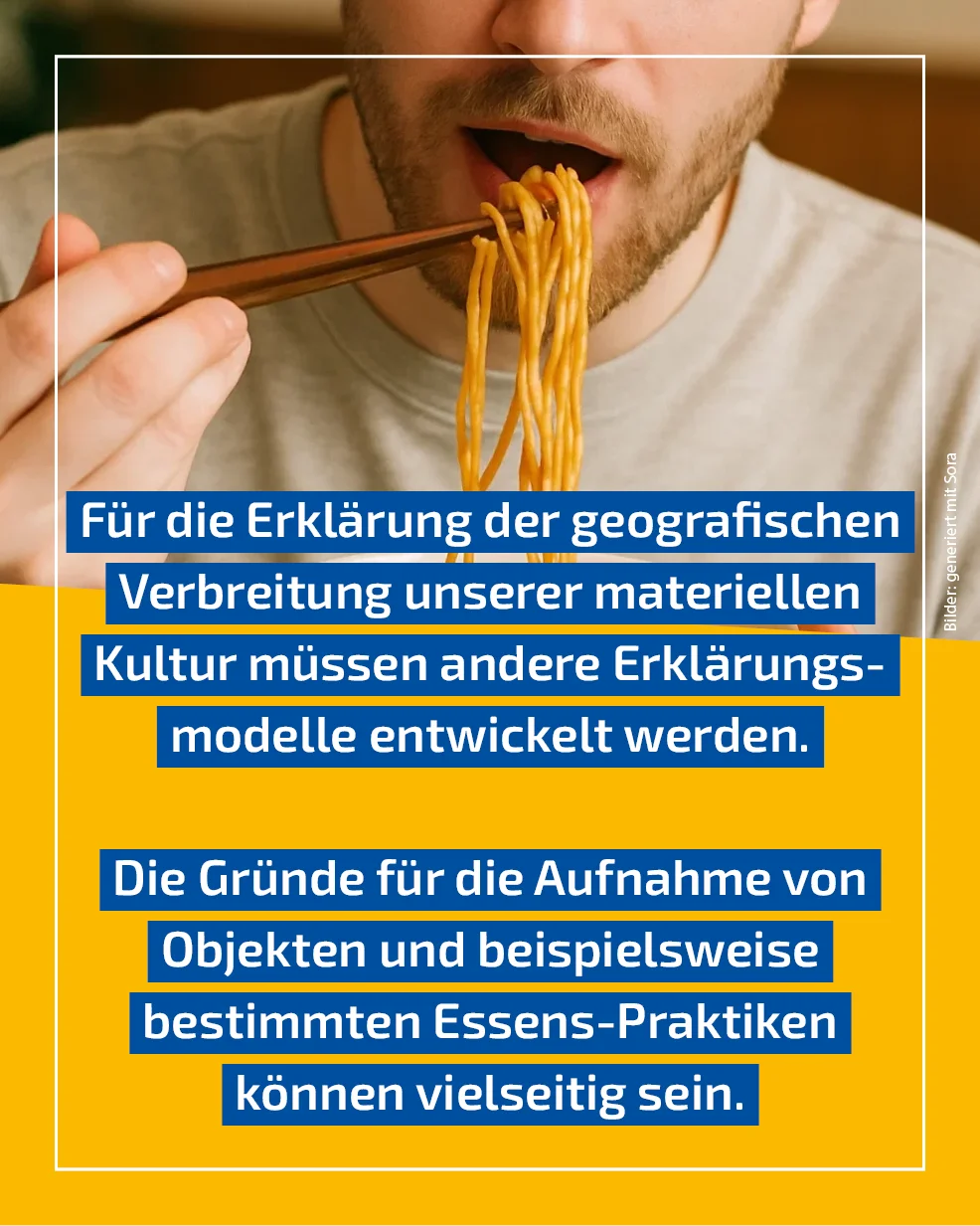Die Problematik ethnischer Zuordnungen in der Archäologie
🔹Begriffe wie „Germanen“ und „Kelten“ sind allgegenwärtig und rufen bestimmte Assoziationen hervor – bei genauerer Betrachtung mögen diese jedoch weder einheitlich noch faktisch richtig sein. Insbesondere die Annahme z.B. der Germanen als statisches, homogenes Volk und als selbst bezeichnende Identität ist problematisch.
🧐 Hintergrund für diese Bezeichnungen sind Bestrebungen, archäologische und geschichtswissenschaftliche Quellen zu verbinden. Bereits im 16. Jh. versuchten humanistische Gelehrte entdeckte Gräber antiken Völkern zuzuweisen. Die Nationalstaatenbildung des 19. Jhs. sorgte durch Legitimierungsversuche von Gebietsansprüchen sowie die Konstruktion nationaler Identitäten für weiteren Aufschwung. Die nationalistische und rassistische Instrumentalisierung der Archäologie für die Verknüpfung von Ethnien, Herkunftsgebieten, materieller Kultur und bestimmten Eigenschaften, wie Intellekt, fand im nationalsozialistischen Deutschland einen Höhepunkt.
☝️ Bis heute dienen ethnische Deutungen, vor allem in der Wissenskommunikation, als Hilfsmittel für vermeintlich klar definierte thematische Eingrenzungen. Scharfe Kritik erfuhr die unreflektierte Zuweisung ethnischer Identitäten zu archäologischen Funden im deutschsprachigen Raum der Gegenwart u.a. von Sebastian Brather (Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie, Geschichte, Grundlagen und Alternativen 2004).
🧬 In Anbetracht neuster genetischer Erkenntnisse gerät der Themenkomplex geografische Herkunft – Identitäten erneut in den Fokus. Dabei spielt vor allem die Frage eine Rolle, ob ethnische Identitäten in der materiellen Kultur ausgedrückt werden, und falls ja, wie diese gegenüber Markern anderer Identitäten abgegrenzt werden können. Archäologisches Material lässt sich, wenn überhaupt, nur unter bestimmten Umständen ethnisch zuordnen. Diese Komplexität spiegelt sich auch in der uns besser vertrauten modernen materiellen Kultur wider.
#vfg_bonn #archaeologie #archeology