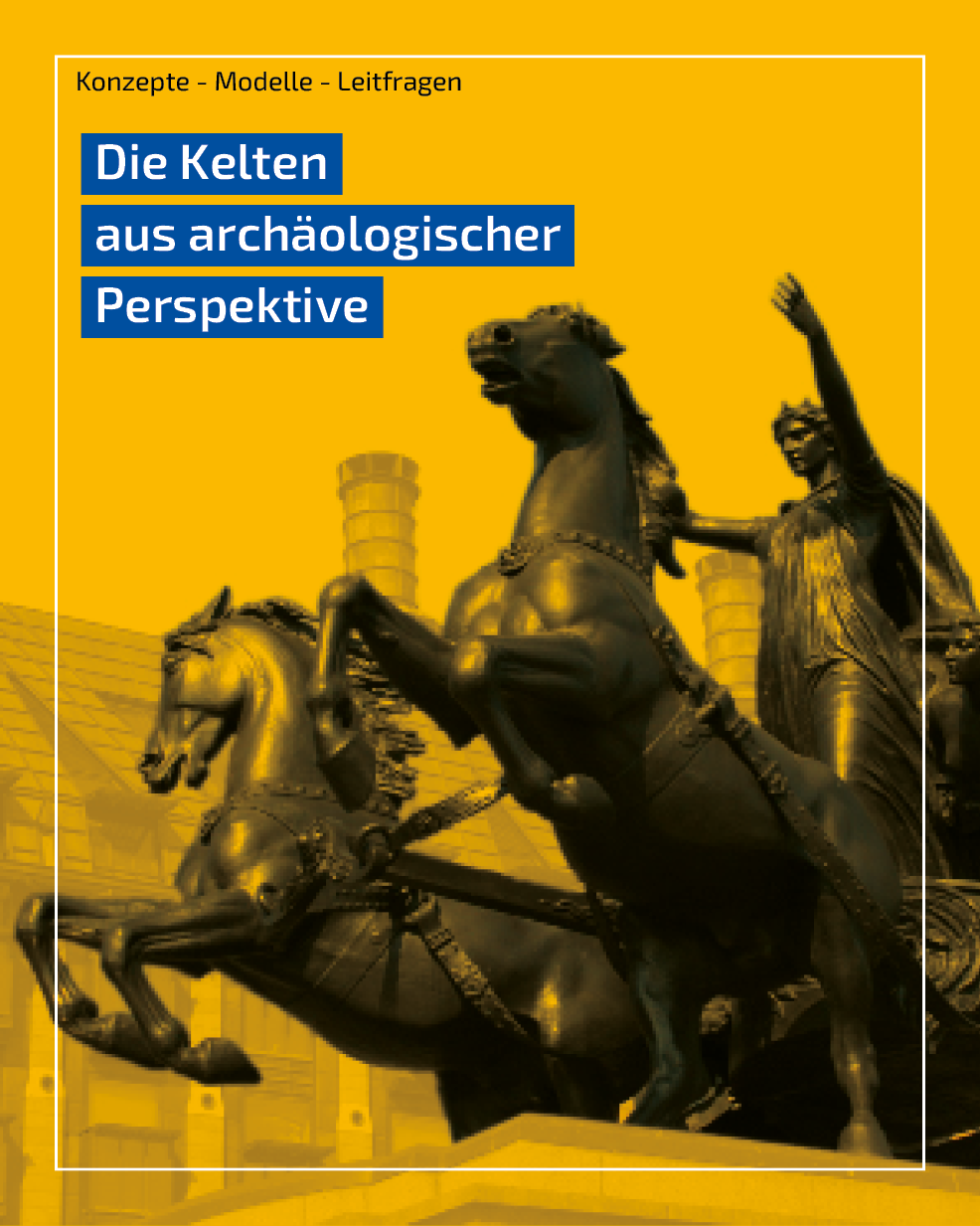Die Kelten – der Begriff ist heute fest etabliert und weckt so manche Assoziation.
Wie bereits in unserem Post zu ethnischen Zuweisungen erklärt, reicht die Idee einer in der materiellen Kultur (angeblich) sichtbaren ethnischen – hier „keltischen“ – Identität weit zurück und gewann durch volkstümliches und nationalistisches Denken im 19. Jh. wieder an Popularität.
Seine Wurzeln hat der Begriff dagegen in der Antike, in denen die BewohnerInnen Galliens als „Keltoi“ (griechisch) oder „Galli“ (lateinisch) bezeichnet wurden. Schriftquellen, in dem sich Personengruppen selbst als Kelten bezeichnen, gibt es nicht und oftmals bleibt unklar, wen die antiken Autoren genau mit den jeweiligen Begriffen bezeichneten. Zudem waren die Fremdzuschreibungen Bestandteile antiker politischer Propaganda und müssen mit dementsprechender Vorsicht interpretiert werden.
Aus archäologischer Perspektive entspricht die „Zeit der Kelten“ der Hallstatt- und Latènezeit (Eisenzeit). Besonders bekannt sind Grabfunde wie der heute rekonstruierte Grabhügel mit Holzkammer von Hochdorf (BW) und die 80 t Blockbergung des Frauengrabs mit Goldohrringen der Bettelbühl-Nekropole in Sichtweite der Heuneburg (BW) – Weiterhin Oppida (befestigte, stadtartige Siedlungen) wie Manching (BY) oder der Glauberg (HE). Die Verbindung von archäologischen und schriftlichen Quellen ergibt sich lediglich in Einzelfällen, zum Beispiel bei der Lokalisation historisch erwähnter Orte. Ein bekanntes Beispiel ist das in Caesar’s De bello Gallico erwähnte Oppidum Alesia auf dem Mont-Auxois bei Alise-Sainte-Reine.
Aus wissenschaftlicher Perspektive stellt der Kelten-Begriff eine retrospektive Konstruktion dar, die heterogene archäologische, sprachliche und kulturelle Phänomene unter einer scheinbar einheitlichen Bezeichnung zusammenfasst. Insbesondere in der Wissenschaftskommunikation findet er nach wie vor Verwendung – dies erfordert eine Reflexion seiner historischen, politischen sowie wissenschaftsgeschichtlichen Kontexte.